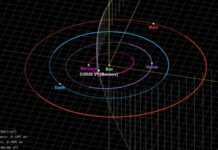Im November 2002 lud ein Mathematiker namens Grigori Perelman stillschweigend eine Arbeit auf einen öffentlichen Server hoch. Die Welt ahnte noch nicht, dass dieser scheinbar gewöhnliche Akt die Lösung eines der größten Rätsel der Mathematik darstellen würde: der Poincaré-Vermutung. Dieses komplexe Problem hatte Mathematiker fast ein Jahrhundert lang verwirrt und seine Lösung erschütterte die Grundfesten der Topologie – dem Zweig der Mathematik, der sich der Untersuchung von Formen widmet.
Was genau war also diese schwer fassbare Vermutung? Stellen Sie sich vor, Sie nehmen ein beliebiges dreidimensionales Objekt, etwa eine Katze oder das Empire State Building, und zeichnen eine zweidimensionale Schleife auf seiner Oberfläche. Wenn man diese Schleife verkleinern könnte, bis sie in einem einzigen Punkt verschwindet, ohne dass entweder die Schleife oder das Objekt selbst zerreißt, dann wäre dieser 3D-Raum nach Poincarés Hypothese mathematisch einer Kugel äquivalent. Im Wesentlichen postulierte es eine grundlegende Beziehung zwischen Krümmung und der Möglichkeit, Schleifen innerhalb dreidimensionaler Räume zu verkleinern.
Während der Mathematiker Stephen Smale bereits 1961 ein ähnliches Problem in fünf Dimensionen erfolgreich gelöst hatte und ihm die begehrte Fields-Medaille der Mathematik einbrachte, blieb der 3D-Fall hartnäckig unlösbar. Der Durchbruch gelang in den 1980er Jahren mit Richard Hamilton, einem Mathematiker der Columbia University, der vorschlug, eine Technik namens Ricci Flow zu verwenden, um das Rätsel zu lösen.
Stellen Sie sich Ricci Flow vor, als würden Sie zerknitterte Plastikfolie mit einem Haartrockner glätten. Es entfernt nach und nach Falten und Krümmungen und vereinfacht komplexe Formen in grundlegendere Formen. In diesem Zusammenhang könnte der Ricci-Fluss theoretisch jede dreidimensionale Form glätten, bis sie einer Kugel ähnelt. Der Haken?
Der Prozess führte oft zu „Singularitäten“ – Punkten von unendlicher Dichte, die den gesamten Ansatz zunichte zu machen drohten. Diese Singularitäten wirkten wie hartnäckige Falten, die sich nicht abflachen ließen. Mathematiker könnten versuchen, sie chirurgisch zu entfernen, aber es bestand immer die Angst, dass unweigerlich neue entstehen würden, was die Lösung unvollständig machen würde.
Perelmans Genie lag in der Lösung dieses Singularitätsproblems. Nach einem Jahrzehnt intensiver Forschung in den USA entschied er sich Mitte der 1990er Jahre, in seine Heimat St. Petersburg zurückzukehren und sich aus dem akademischen Rampenlicht zurückzuziehen.
Er wurde ein Einsiedler, von Kollegen als „weltfremd“ beschrieben, mit langen Haaren und Fingernägeln, die an die historische Figur Rasputin erinnerten. Er konzentrierte sich ausschließlich auf seine Arbeit und verschwand oft tagelang in seiner Wohnung, wo er Berichten zufolge in seiner Freizeit durch nahegelegene Wälder wanderte oder Pilze suchte. Ruhm oder materieller Reichtum schienen ihm völlig gleichgültig zu sein.
Aus dieser unerwarteten Stille entstanden dann die drei bahnbrechenden Arbeiten, die zwischen 2002 und 2003 veröffentlicht wurden. Darin skizzierte Perelman akribisch seine Lösung für das Singularitätsproblem – und bewies, dass diese problematischen Punkte zwangsläufig in handhabbare Formen wie Kugeln oder Röhren vereinfacht wurden. Er zeigte, dass sich jede komplexe 3D-Form letztendlich in eine Kugel verwandeln würde, wenn man Riccis Fluss geduldig bis zu seinem logischen Ende verfolgte.
Die Poincaré-Vermutung war endlich gelöst.
Obwohl es mehrere Jahre dauerte, bis die Mathematiker die komplizierten Details von Perelmans Beweisen vollständig verstanden und verifiziert hatten, galt seine Arbeit als monumentale Errungenschaft in der Topologie. Im Jahr 2006 veröffentlichten die Kollegen John Morgan und Gang Tian ein umfangreiches 473-seitiges Papier, in dem sie Perelmans Lösung bestätigten. Die mathematische Gemeinschaft feierte ihn als Visionär, und als Anerkennung für seine bahnbrechende Arbeit wurden Perelman sowohl die prestigeträchtige Fields-Medaille als auch der Clay Millennium Prize (komplett mit einer Auszeichnung in Höhe von 1 Million US-Dollar) verliehen.
Er lehnte beide Auszeichnungen ab, da er Berichten zufolge Bedenken hinsichtlich der Verteilung der Anerkennungen in der Welt der Mathematik hatte. Perelman trat 2005 von seiner Position am Steklow-Institut zurück und zog sich vollständig aus dem öffentlichen Leben zurück. Er bleibt weitgehend ein Einsiedler und lebt ruhig in seiner Wohnung in St. Petersburg, wo er sich laut Nachbarn um seine alte Mutter kümmert. Sein Vermächtnis ist ein Beweis für die Kraft des einsamen Genies und die Bescheidenheit bahnbrechender mathematischer Entdeckungen.